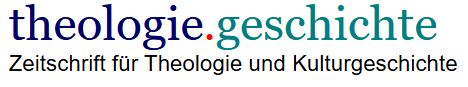Missbrauch, Macht und Medien – was uns die Geschichte der alt-katholischen Kirche zeigt
2025-11-04
Missbrauch – sei er körperlich, seelisch oder spirituell – ist kein neues Phänomen. Theresa Hüther zeigt in ihrem Artikel „Berichterstattung in der deutschen altkatholischen Presse über sexuellen und spirituellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche Ende des 19. Jahrhunderts“, dass die Auseinandersetzung mit sexuellem und spirituellem Missbrauch bis in das ausgehende 19. Jahrhundert zurückreicht. Schon damals wurde in der alt-katholischen Presse offen über Fälle von Übergriffen und Vertuschung berichtet, die man heute als „klassische Missbrauchsgeschichten“ bezeichnen würde: Priester, die ihre Machtposition ausnutzten, Klosterschulen, in denen Schülerinnen Opfer wurden, und kirchliche Strukturen, die Täter schützten.
Besonders die Kritik an ultramontanen Frömmigkeitsformen, die sich in einer unreflektierten Unterordnung unter die Autorität der Kirche und des Papstes äußerten, zog sich wie ein roter Faden durch die Zeitungsartikel. Die alt-katholische Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die dogmatische Verabsolutierung der päpstlichen Lehrunfehlbarkeit und des Jurisdiktionsprimats im Kontext des Ersten Vatikanischen Konzils entstand, kritisiere, dass spiritueller Missbrauch und gezielte Manipulation oft auch durch sexualisierte Sprache, sexuelle Gewalt häufig nicht nur begünstigten, sondern nicht selten auch vorbereiteten und ermöglichten.
Besonders interessant ist dabei, dass schon im 19. Jahrhundert über strukturelle Ursachen gesprochen wurde, wie etwa über die Zölibatspflicht oder die Beichtpraxis. So wurden Machtmissbrauch und die dadurch resultierenden Missbrauchsfälle nicht als moralisches Versagen Einzelner gesehen, sondern als Ergebnis eines Systems, das Abhängigkeit und Schweigen förderte.
Hüther zeigt damit, dass keinesfalls Wissen über Macht-, sowie spirituellen und sexuellen Machtmissbrauch fehlte, sondern der römisch-katholischen Kirche schlichtweg die Bereitschaft fehlte, ihre eigenen Strukturen zu hinterfragen. Die Weiterentwicklung kirchlicher Strukturen, wie einer veränderten Beichtpraxis, die Aufhebung der Zölibatspflicht oder auch ein Disziplinarstatut für Geistliche, dass die Entlassung sexuell übergriffiger Priester regelt, können zur Verhinderung von spirituellem uns sexuellem Missbrauch sowie Machtmissbrauch beitragen.
Die offene Auseinandersetzung mit kirchlichen Missbrauchsskandalen ist daher nicht nur modernes Phänomen. Sie sorgt heute dafür, dass Opfer den Raum bekommen, offen über ihre Erfahrungen sprechen zu können.
Lesen Sie mehr in dem auf theologie.geschichte veröffentlichen Artikel: DOI: https://doi.org/10.48603/tg-2025-art-4